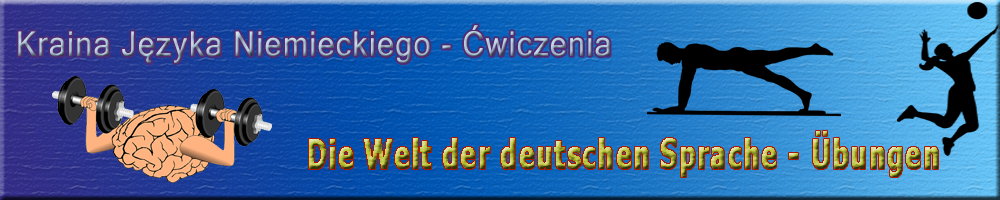Teksty do czytania
Aby cwiczyć rozumienie tekstów należy dużo czytać. Na początku nauki warto korzystać z prostych tekstów dostępnych na stronach do nauki jezyka. Zawierają one prostsze słonictwo a temayka nie jest skąplikowana
Będąc już na wyzszym poziomie dobrze jest czytać niemieckojęzyczne portale internetowe. Ilustacje, zdjęcia czy info-grafika ułatwia zrozumienie danego tekstu.
Poniżej kilka tekstów do czytania [źródła: Internet], dodatko pod tekstami umieszczone jest nagranie dzwiękowe. Czyta lektor Hans z programu Ivona2.
Zestaw 4 - Mittelschwere Texte
Teksty pozim truności - Mittelschwere Texte
1. Wir bauen uns eine Hütte
Auf einer kleinen Waldlichtung hinter dem Südhof gibt es viele kleine, flache Klippen und Steine. Das war unser Lieblingsplatz. Dort spielten wir: Britta, Inga und ich. Eines Tages hatte Britta einen Einfall. Wir sollten uns eine eigene kleine Hütte in einer Spalte zwischen ein paar Felsblöcken einrichten. Nein, war das lustig! Es war die schönste Hütte, die wir je gehabt hatten. Ich fragte Mutti, ob wir nicht einen kleinen Flickenteppich mitnehmen dürften. Das durften wir. Wir legten ihn auf den glatten Steinboden und da sah es noch mehr wie ein Zimmer aus. Von Agda bekamen wir noch eine alte Felldecke. Darauf wollten wir schlafen. Dann holten wir ein paar Zuckerkisten und stellten sie als Schränke und Kommoden auf, und die größte stellten wir in die Mitte als Tisch. Britta lieh sich ein kariertes Kopftuch von ihrer Mutter, das legten wir als Decke über den Tisch. Dann holte sich jeder eine Fußbank. Die stellten wir in eine Ecke und setzten unsere Puppen darauf. Inga war unser Kind und durfte in der Puppenecke spielen. Ich brachte auch mein hübsches rosa Puppengeschirr und Inga ihre kleine geblümte Limonadenkanne mit den Gläsern. Wir stellten das alles in die Zuckerkisten. Zuletzt pflückten wir Glockenblumen und Margeriten, die wir in ein Einmachglas mitten auf den Tisch stellten. "Kommt jetzt zum Essen", sagte Britta, denn sie war die Hausfrau. "Aber zuerst müsst ihr euch die Hände waschen." Wir liefen die Klippen hinunter zu der nahen Bucht und wuschen unsere Hände. Als wir zurückkamen, sagte Britta: "Wir brauchen noch eine Feuerstelle zum Kochen. Vielleicht helfen uns die Jungen dabei." Da gingen wir zu Bosse und Lasse, um sie zu fragen.
[ Nach Astrid Lindgren ]
Fragen:
1. Was befindet sich hinter dem Südhof?
2. Was für einen Einfall hatte Britta?
3. Was haben die Kinder von Agda bekommen?
4. Wohin haben sie die Blumen gesteckt?
5. Wen wollten die Mädchen um Hilfe bitten?
2. Svetlana trägt eine Zahnspange
"Früher wollte ich unbedingt eine Zahnspange tragen. Alle meine Freunde hatten eine. Ich fand das toll. Ich habe mich deshalb richtig gefreut, als ich eine Klammer bekommen sollte. Allerdings sollte sie festsitzen. Die meiner Freunde konnte man herausnehmen. Zahnspangen können ganz schön nerven. Besonders am Anfang tut das ziemlich weh. In der ersten Woche konnte ich nur Suppe essen. Es tat schon weh, wenn ich einen Löffel in den Mund steckte. Schlimm ist es auch, wenn man mit einer Zahnspange in einen Apfel beißt. Ständig bleibt etwas vom Apfel an der Klammer hängen. Oder Kaugummikauen! Der Zahnarzt hat es allen meinen Freunden verboten. Die Befestigung der Klammer kann sich dabei lösen. Na ja, ich kaue jetzt auch ganz vorsichtig. Aber auf Kaugummikauen könnte ich niemals im Leben verzichten! Panische Angst habe ich davor, Karies zu bekommen. Durch die Klammer sind die Zähne besonders gefährdet . Nach jedem Stückchen Schokolade putzte ich deshalb meine Zähne sehr gründlich. Wäre das nicht furchtbar: Man ist die Klammer los und hat gerade, aber verfaulte Zähne!? Manche nennen ihre Klammer aus Spaß "Schneeketten" oder "Fressgitter". Ich habe mich heute an meine Klammer gewöhnt. Sogar beim Küssen stört die Klammer nicht, hab' ich mir sagen lassen. Trotzdem freue ich mich schon auf den Tag, an dem ich meine "Schneeketten" wieder los sein werde. Einige Freunde haben mir erzählt, dieser Tag sei viel schöner als Weihnachten."
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Warum wollte Svetlana eine Zahnspange tragen?
2. Warum war sie enttäuscht?
3. Was hat ihr der Zahnarzt verboten?
4. Wovor hat sie panische Angst?
5. Wie werden die Zahnspangen genannt?
3. Globetrotter des Rock' n' Roll
Es war Anfang der 70-er Jahre. Englische Bands wie Led Zeppelin oder Deep Purple waren die Stars des Hard Rock. Dann kamen die Scorpions aus Hannover. Lange Touren durch das europäische Ausland, phantastische Konzerte - das waren ihre Markenzeichen. Vor allem in Frankreich, später dann auch in Japan hatten die "Scorps" die treuesten Fans. 1979 gelang ihnen der Sprung in die USA, 1984 folgte eine Welt-Tournee. Zu 203 Konzerten kamen über 2 Millionen Zuschauer. Ein Jahr später war Frankreich im Scorpions-Fieber. Die Ursache war die Rock-Ballade "Still Loving You" mit 1,7 Millionen verkauften Schallplatten. Das Fieber steckte an: Endlich kam auch die Anerkennung in Deutschland. Nur der Osten Europas blieb verschlossen - bis 1988. Es gab zehn ausverkaufte Rockkonzerte in Leningrad. Das hatte es in der Sowjetunion noch nicht gegeben. Nur ein Jahr später feierten 200.000 Fans die deutsche Band beim "Moscow Peace-Festival". Ihre Erfahrungen verarbeiteten die fünf Rockmusiker wieder in einer Ballade: "Wind of Change". Das Lied wurde zur Hymne. Auf einmal kamen ganz neue Zuhörer zu den Konzerten. Neben 20-Jährigen in Leder und Jeans standen jetzt 40-Jährige im guten Anzug. Aber auch die ganz Jungen begeisterten sich jetzt für den harten Rock. In Teenager-Zeitschriften war die Band monatelang in den Schlagzeilen und Hitlisten.
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Welche englischen Bands waren die Stars des Hard Rock?
2. Wo hatten die Scorpions die treuesten Fans?
3. Wo gab es zehn Rockkonzerte?
4. Welches Lied wurde zur Hymne des Festivals in Moskau?
5. Wofür begeisterten sich die Jungen?
4. Wenn Olaf Franzis Briefe liest
Alles begann mit einer Wette: Der 18-jährige Olaf wollte eine Prominente zum Essen überreden. Für ihn war sonnenklar: Die Prominente konnte nur Schwimm-Ass Franzi von Almsick sein. Die hatte der Berliner Briefträger ein paar Wochen zuvor bei einer Autogramm-Stunde kennen gelernt. Doch Olaf hatte ein Problem. Er wusste nicht, wo Franzi wohnte. Ein Freund, der die Adresse kannte, half weiter. So machte sich Olaf auf den Weg in den Stadtteil Treptow. "Ich wollte Franzis Mutter um Hilfe bitten", erinnert sich Olaf. "Doch dann machte Franzi selbst die Tür auf. Sie erkannte mich wieder und war sofort begeistert von der Wett-Idee." Das war vor zwei Jahren, kurz vor Weihnachten. Einige Male traf sich Olaf auch nach dem Wett-Abendessen mit Franzi. Um die Fanpost kümmerte sich Franzis Bruder. "Damals, nach der Weltmeisterschaft in Rom, kamen teilweise um die 2000 Briefe in der Woche." Familie von Almsick überließ schließlich Olaf die Beantwortung. "Weil ich sowieso bei der Post arbeite", meint Olaf scherzhaft. Und weil er bei den meisten Fragen auch schon die Antworten hatte. Schließlich war Olaf bereits vor der Wette Franzi-Fan und hatte zahlreiche Zeitungsausschnitte gesammelt. "Franzi sagte, dass ich das ruhig weitermachen soll", sagt Olaf. "Dann kann sie nachlesen, was so über sie geschrieben wird - teilweise ein ganz schöner Unsinn." Mittlerweile ist Briefträger Olaf Franzis persönlicher Fanpost-Beantworter. "Seit Februar ganz offiziell", sagt Olaf nicht ohne Stolz. Und was steht in den Briefen? "Manche Leute nerven einfach nur, sie schreiben jeden zweiten Tag und erzählen nur Unsinn über sich", meint Olaf. "Doch die meisten sind ganz nett." Rund 50 Briefe holt Olaf wöchentlich aus dem Postfach. "Seit bekannt ist, dass Franzi einen Freund hat, kommt merklich weniger Post", hat Olaf festgestellt. "Früher kamen viele Liebesbriefe."
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Wer ist Franzi von Almsick?
2. Wie hat Olaf Franzis Adresse gefunden?
3. Womit beschäftigt sich Olaf?
4. Wer machte das vor ihm?
5. Wie viel Briefe gibt es jede Woche?
5. Puccini im Schlaf
Im Musiksaal der Freusburg (bei Siegen im Sauerland) übt das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule Köln. Man studiert die italienische Oper "La Bohéme" von Giacomo Puccini ein. "Normalerweise proben wir einmal wöchentlich in Köln", erzählt Jochen. "Leider können nicht immer alle Leute daran teilnehmen. Viele haben nachmittags Schule, studieren oder gehen arbeiten. Darum haben wir uns entschieden hierher zu fahren und einen ganzen Tag zu üben". Jochen (19) ist Student und spielt wie Magdalena Geige. 14 bis 28 Jahre sind die 70 Musiker alt - oder besser jung. Alle Instrumente eines klassischen Orchesters sind vertreten. Wie kommt man dazu, ein Instrument wie Bratsche zu spielen? Gerhard (17) lacht: "Da hört man viele dumme Geschichten. Oft wird behauptet: Der Vater spielte Klavier, die Mutter Geige, der Opa Horn. Irgendwie brauchte man noch eine Bratsche oder einen Kontrabass. Tja, und dann musste der Sohn halt eines der beiden Instrumente lernen. Aber das ist meistens alles Unsinn. Ich bin auf Bratsche umgestiegen, weil ich auf der Geige mit den Fingern nicht schnell genug war. So einfach ist das. "Um in das Jugendsinfonieorchester aufgenommen zu werden, muss man wenigstens ein Instrument wirklich gut beherrschen. Die meisten der jungen Musiker spielen aber zwei Instrumente. Manche haben außerdem eine sehr gute Stimme. Sie singen nicht nur Opernarien, sondern auch Lieder aus Musicals und Schlager von Frank Sinatra, Barbara Streisand oder aus Kinofilmen wie dem "Dschungelbuch". Die Jugendlichen spielen zwar Klassik, hören aber keineswegs nur klassische Musik, sagt Anna (17). Sie spielt im Orchester Waldhorn. "Außerdem ist da noch die Schule. Viele von uns üben fürs Abitur. Selbst heute in den Pausen haben manche ihre Biologie-Bücher ausgepackt und Genetik gelernt". Dirigent Egon Josef Palmen gibt sich viel Mühe mit den jungen Musikern. Anna erzählt: "Er wählt eigentlich fast immer nur interessante Stücke aus. Außerdem hat er ziemlich viel Geduld. Er weiß, dass an manchen Tagen einfach der Wurm drin ist. Herr Palmen klopft mit dem Taktstock auf seinen Notenständer. "So, Leute, es geht weiter. Wir beginnen im 4. Akt, Ziffer 11." Einige stimmen noch ihre Instrumente. Magdalena, die die erste Geige spielt, gibt den Ton vor. Herr Palmen zählt im Takt und das Orchester setzt ein. "Einige von uns sehen die Noten heute Abend wahrscheinlich noch im Schlaf", flüstert Anna.
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Was übt das Jugendsinfonieorchester?
2. Wo gibt es ihre Musikschule?
3. Warum ist Gerhard auf Bratsche umgestiegen?
4. Was singen die Jugendlichen?
5. Wer spielt die erste Geige?
6. Rock sollte es werden
Aus dem Bungalow dröhnt der Bass. Als das Schlagzeug einsetzt, kommt eine Frau mit einem Korb Unkraut um die Hausecke und verschwindet damit hinter den Tannen ihres Gartens. Die Straße ist leer, der Tag geht zu Ende und leise klingelt der Gesang einer Rock-Ballade durch die Neubausiedlung: "Two Men in One ..."
Der Übungsraum der Paradocs ist der Partykeller von Holgers Eltern. Sie wohnen in Scharnebeck, einer 3000-Seelen-Gemeinde mit dem größten Schiffshebewerk Europas, zehn Bauernhöfen, fünf Kneipen und einer Kirche. Scharnebeck war einmal ein Dorf, man sieht es noch am alten Ortskern. Jetzt wohnen hier allerdings nur noch die Menschen, die tagsüber in Lüneburg oder Lauenburg arbeiten. Die Gegend ist Provinz.
"The are two men in once, and he can´t see the sun, but his bright face is a light of my own." Marc, der Sänger und Texter der Gruppe, singt über seinen blinden Großvater. Von Alltäglichem erzählen die Lieder der Band, die Arrangements bastelt man gemeinsam zusammen. Holger, der Schlagzeuger, und Andreas, der Gitarrist, stammen aus Scharnebeck, Marc, Carsten und Micky sind aus Lauenburg. Dort am Gymnasium haben die fünf Freunde vor vier Jahren beschlossen eine Rockband zu gründen. Kurz vor dem Abitur. Micky hatte klassischen Klavierunterricht gehabt, Holger trommelte versuchsweise Jazz, und Carsten hatte Hendrix' Gitarrenspiel im Kopf. Andreas konnte kein Instrument - er musste also das Bassspiel lernen; blieb noch Marc, der sich für Gesang entschied. Alles ziemlich zusammengewürfelt, gegensätzlich. Aber Rockmusik sollte es werden - fast schon paradox - so entstand der Name der Band
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Was hat die Frau in ihrem Korb?
2. Was ist Scharnebeck?
3. Was für Leute wohnen dort?
4. Worüber singt Marc?
5. Was musste Andreas lernen?
7. Karriere am Seil
Noch hängt die siebzehnjährige Sabine an der Leine. Um die Hüfte trägt sie einen breiten Gürtel aus Leder mit einem Seil daran. Das andere Ende des Seils hält Manfred Bergner in der Hand. Er ist Sabines Lehrer. Zusammen mit Alex und Marko probiert Sabine eine "Dreierpyramide". Dabei steht Alex ganz unten, auf seinen Schultern Marko und ganz oben Sabine. Dieser "Trick", wie es in der Zirkussprache heißt, ist ein Teil des Schulunterrichts. Sabine, Alex und Marko wollen "staatlich geprüfte Artisten" werden. Darum besuchen sie Deutschlands einzige Artistenschule in der Berliner Friedrichstraße. "Andere Berufe sind mir viel zu langweilig", sagt Sabine, die aus Schwedt an der Oder kommt. Sie turnt seit ihrem fünften Lebensjahr. Marko (16) aus Dresden ist deutscher Meister im Trampolinspringen. Alex (18) kam ohne eine artistische Grundausbildung aus Frankfurt / Main nach Berlin. Für ihn stand nach der Realschule fest: "Für mich gibt's nichts anderes als Zirkus". Weil er kräftig war, nahmen ihn die Lehrer an. Gerd Krija, künstlerischer Leiter der Schule, sagt: "Wer den Ball auf den Fingern balancieren kann, aber keine körperlichen Belastungen kennt, hat wenig Chancen". Jonglieren sei ein Mode-Hobby, meint der Lehrer, aber: "Wer jongliert, ist noch lange kein Artist". Wer vier Jahre an der Berliner Schule war, kann mehr: Akrobatik, Trapez, Jonglieren, Drahtseil und Equilibristik (Gewichtsübungen und Balanceakte), aber auch Clownerie gehören zur Grundausbildung. Auch Ballettunterricht erhalten die Schüler. Später kann man sich dann spezialisieren. Zum Abschluss muss man eine artistische Darbietung zeigen, die gut genug für den Zirkus ist. Schon während der Ausbildung sollen sich die Artistenschüler an das Publikum gewöhnen. Alle Schulprüfungen sind öffentlich. Eine gute Gelegenheit, Verwandte und Freunde einzuladen. "Meine Eltern waren ganz begeistert", erinnert sich Sabine an die ersten Vorführungen. Markos kleiner Bruder will sich auch an der Schule bewerben.
Vier Jahre dauert die gesamte Ausbildung. Wer vorher abgehen möchte, kann das nach Erreichen des Realschulzeugnisses. "Wir sind nicht böse, wenn jemand aufhört", meint Gerd Krija, "doch am Anfang sollte schon der Wille dasein durchzuhalten."
[[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Wie alt ist Sabine, woher kommt sie und was für eine Schule besucht sie?
2. Wer ist Manfred Bergner?
3. Wo befindet sich die Schule?
4. Was gehört zur Ausbildung?
5. Was Besonderes gibt es an den Prüfungen?
8. Walter und die Turbo-Tauben
Vor sechs Jahren flatterten die ersten Tauben ins Haus der Reiters. Es waren ganz normale Haustauben. Walter baute einen Käfig für die Vögel und fütterte sie. Dann verirrte sich die Brieftaube eines Nachbarn und landete bei Walter. Der Nachbar schenkte ihm das Tier. Walter wurde Mitglied beim Brieftauben-Verein "Heimattreue" und bekam bereits im ersten Jahr den Titel des deutschen Jugendmeisters. Walter führt uns auf den Dachboden. 220 leben hier. Der Star hat die Nummer 267 und ist die zweitschnellste Taube des Jahres. Der Vogel gewann einen Flug von Ostende in Belgien ins schwäbische Donauwörth, Walters Heimat. Lastwagen bringen die Tauben zum Startort. Walter wartet zu Hause, bis die Tauben eintreffen. Dann drückt er eine Zeituhr. Nicht immer kommen alle Tauben zurück. Raubvögel und schlechtes Wetter sind die beiden größten Gefahren. "Dieses Jahr habe ich 70 Prozent verloren", erzählt Walter. Erstaunlich ist, dass die Tauben den Weg nach Hause finden. Es gibt verschiedene Theorien. "Ich glaube, die Tauben empfangen starke Schwingungen aus ihrem Heimatschlag", meint Walter. Seit dem Altertum nutzt man diese Eigenschaft. Als Kuriere transportierten Tauben Briefe mit militärischen und politischen Informationen. Erst in diesem Jahrhundert wurden sie zu Leistungssportlern. Für die Wettkämpfe muss man die Tauben trainieren. Walter fährt regelmäßig mit seinen Tieren bis zu 50 Kilometer fort. Dann lässt er die Tauben zurückfliegen. Aber er muss noch mehr für seine Tiere tun: Täglich füttern, alle zwei Tage die Käfige reinigen und die Vögel medizinisch betreuen. Brieftauben sind ein teures Hobby. Doch als Lohn gibt es Titel und Pokale für erfolgreiche Flüge.
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Seit wann besitzt Walter seine Vögel?
2. Was für Vögel sind das?
3. Was für Strecke musste seine schnellste Taube zurücklegen?
4. Welche Aufgabe hatten Tauben im Altertum zu erfüllen?
5. Auf welche Art und Weise betreut Walter seine Tiere?
9. Engel unter Berlin
Die Engel kommen bei Nacht. Sie tragen rote Jacken, weiße T-Shirts und rote Mützen. Ihre Ausrüstung: Personalausweis, Trillerpfeife, Erste-Hilfe-Ausrüstung und eine Monatsfahrkarte der Berliner Verkehrsbetriebe. Die Fahrgäste gegen "Gewalt, Rassismus und Sexismus" schützen: So lautet der Anspruch der Gruppe, die seit einem Jahr in Berlin unterwegs ist. Die Idee des privaten Sicherheitsdienstes stammt aus New York. Dort wurden die "Guardian Angels" - Wächter-Engel auf Deutsch - 1979 gegründet. "Wir lehnen Gewalt ab und möchten allein durch unsere Anwesenheit eventuelle Täter abschrecken", sagen die meist jungen Mitglieder. Das Engagement sehen nicht alle Berliner gleich positiv. Immerhin: Jugendsenator Thomas Krüger (SPD) nennt sie "ein interessantes Experiment im Kampf gegen Gewalt". Barbara John (CDU), Ausländerbeauftragte des Senats, freut sich über die 19 verschiedenen Nationalitäten der Gruppe.
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Wann kommen die Engel?
2. Was ist ihre Ausrüstung?
3. Woher kommt diese Idee?
4. Wie lautet der Anspruch der Gruppe?
5. Worüber freut sich Barbara John?
10. Bretter, die die Welt bedeuten
(Kinder aus 24 Nationen spielen Theater)
Paola Palacio aus Peru ist glücklich. In einer Woche hat die Schülerin neun Brieffreundinnen und -freunde gefunden. Dabei ist sie eigentlich aus einem anderen Grund nach Deutschland gekommen. Paola spielt Theater. Zusammen mit 400 anderen Kindern zeigt sie ihr Können beim 3. Welt-Kindertheater-Fest in Lingen. Über 20 Theaterstücke stehen auf dem Programm. Aus der Türkei kommt die Gruppe "Olusum Tiyatrows". Ihr Motto heißt: "Kunst mit Kindern, Kunst für eine bessere Welt." Die lettischen Kinder zeigen wie ein Schiffskapitän und ein Pilot auf eine Reise gehen. Paolas Gruppe "Centro Cultural Nostros" aus Lima spielt ein Stück über die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen.
Alle Vorstellungen sind gut besucht: 500 bis 800 junge und alte Zuschauer kommen täglich ins Theater. Kein Wunder, dass einige Akteure ein bisschen nervös sind. Betreuer und Regisseure helfen, wo sie können. Doch auf der Bühne klappt alles bestens. Auch wenn man die Worte nicht versteht. Die Handlung der Stücke bleibt nie unklar. Die Kinder "sprechen" mit Gesten und Mimik. Auch zwischen den einzelnen Gruppen ist die Atmosphäre gut. "Jeder macht alles, alle fassen an. Die Leute feiern sich selbst", meint Dr. Bernd Ruping. Der künstlerische Leiter des Festivals ist am Wochenende erschöpft, doch man sieht seine Freude über den Erfolg.
"All together now" - alle zusammen - heißt das Lied, das deutsche Schüler für das Fest komponiert haben. Am Ende der Woche haben es alle in den Ohren.
[ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von JUMA, www.juma.de ]
Fragen:
1. Woher kommt Paola?
2. Wie viel Theaterstücke stehen auf dem Programm?
3. Wie heißt die türkische Gruppe?
4. Wer ist Dr. Bernd Ruping?
5. Wie heißt das Lied, das deutsche Schüler komponiert haben?